Strukturwandel im Burgenlandkreis
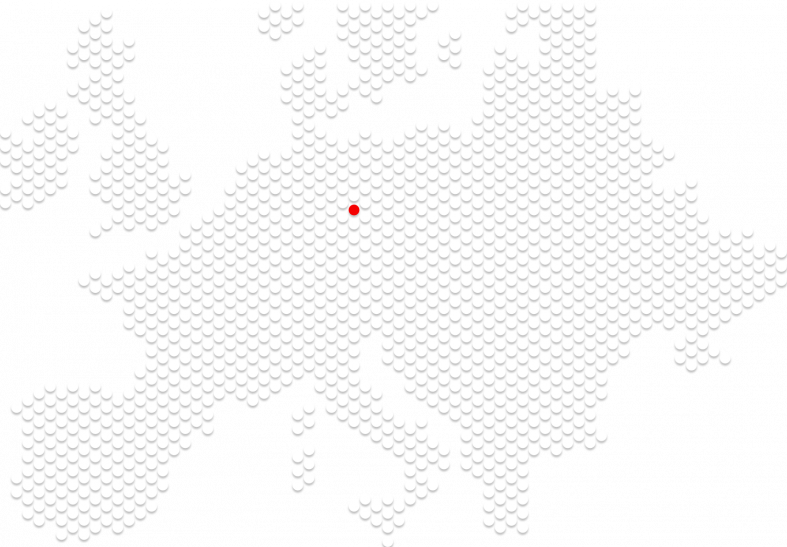

Ziel der Zusammenarbeit
Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, aus der Perspektive der lokalen und regionalen Akteur:innen heraus, Hebel und Wege für die mit dem Strukturwandel im Zusammenhang stehende Resilienz zu identifizieren. Dabei beleuchten wir die folgenden zentralen Fragen: Wie begreifen lokale und regionale Akteur:innen ‘Resilienz’ und wie gehen sie diese Prozesse an? Welche Auswirkungen hatte und hat der ‘Strukturbruch’ der 90er Jahre auf die Ansichten und Lebenswelten von Menschen in der Region? Welche neuen Herausforderungen verbinden die Menschen mit dem aktuellen Strukturwandel? Gemeint ist damit der deutschlandweite Kohleausstieg und die damit einhergehende Stilllegung des MIBRAG-Tagebaus Profen und das Aus begleitender Industriezweige. Wie stellen sich die Bürger:innen die Zukunft ihrer Region vor? Was sind wesentliche Hebel und Wege, Problemen wie der Abwanderung von erwerbsfähigen Menschen und Familien sowie dem Verlust von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken?
Geschichte
Im 19. Jahrhundert entwickelt sich Zeitz zur Industriestadt. Sie wird unter anderem als Zentrum der deutschen Kinderwagenindustrie, des Maschinen- und Klavierbaus bekannt. Viele dieser Betriebe wurden nach 1990 geschlossen. Inzwischen konnten einige der ehemaligen Betriebsstandorte neu belebt und so neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Stadt ist zugleich jedoch stark von Überalterung und Wohnleerstand betroffen. Außerdem steht die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) – ein langjähriger, wichtiger Arbeitgeber der Region – vor großen strukturellen Herausforderungen.
Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich die Region um Hohenmölsen zum Zentrum des Bergbaus. Durch den Zuzug von Arbeitskräften in der Montanindustrie wächst die Stadt zunächst. Zudem siedelten in den 1930er Jahren Menschen aus umliegenden Gemeinden, die für den Bergbau weichen mussten, nach Hohenmölsen um. Nach 1990 verlor der Bergbau jedoch zunehmend an Bedeutung. Seit den 2000ern ist die Stadt zudem von Abwanderung und Überalterung betroffen.
Interview mit Thomas Haberkorn, Mit-Gründer des Vereins "Kloster Posa"
Dialogreihe zwischen dem Burgenlandkreis und Dünkirchen
Zeitstrahl
Um 1840 Beginn der Braunkohleförderung und damit verbundene industrielle Entwicklung
Nach 1945 Mitteldeutschland avanciert zum wichtigsten deutschen industriellen Zentrum
Nach 1990 Deindustrialisierung. 80% der Chemiearbeiter:innen und 90% der Bergleute verlieren ihre Arbeitsstelle, 2/3 davon Frauen. ¼ der Zeitzer Einwohner:innen wandert ab.
2020 Das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ und „Kohleausstiegsgesetz“ werden verabschiedet
2020/2021 Zahlreiche Projekte werden im Rahmen der Strukturstärkung durch den Bund gefördert
2021 Ein Teil der Stabsstelle Strukturwandel des BLK nimmt seine Arbeit auf [1]
2021 Eröffnung des Zeitzer Strukturwandelstabes „Projektbüro Stadt der Zukunft“
[1] https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html
Zeitz in Bildern




Zeitstrahl
Beginn der Braunkohleförderung und damit verbundene industrielle Entwicklung.
Mitteldeutschland avanciert zum wichtigsten deutschen industriellen Zentrum.
Deindustrialisierung. 80% der Chemiearbeiter:innen und 90% der Bergleute verlieren ihren Arbeitsplatz, 2/3 davon Frauen. ¼ der Zeitzer Einwohner:innen wandert ab.
Das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ und „Kohleaus-stiegsgesetz“ werden verabschiedet.
Das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ und „Kohleausstiegsgesetz“ werden verabschiedet.
Zahlreiche Projekte werden im Rahmen der Strukturstärkung durch den Bund gefördert.
Offizielle Eröffnung der Zeitzer Stabsstelle für Strukturwandel „Projektbüro Stadt der Zukunft“.






















